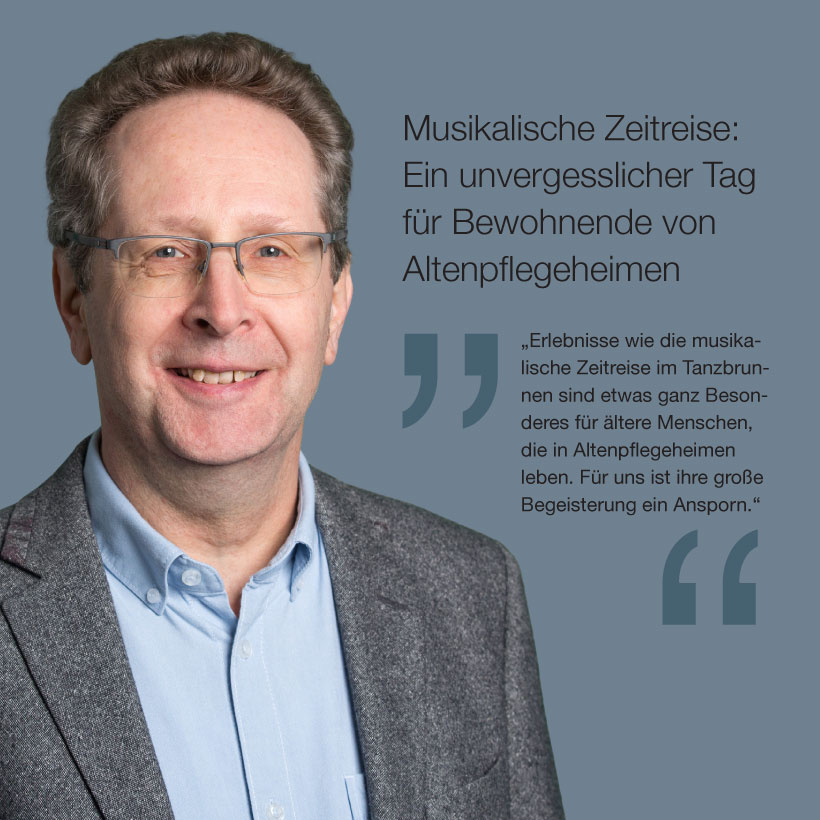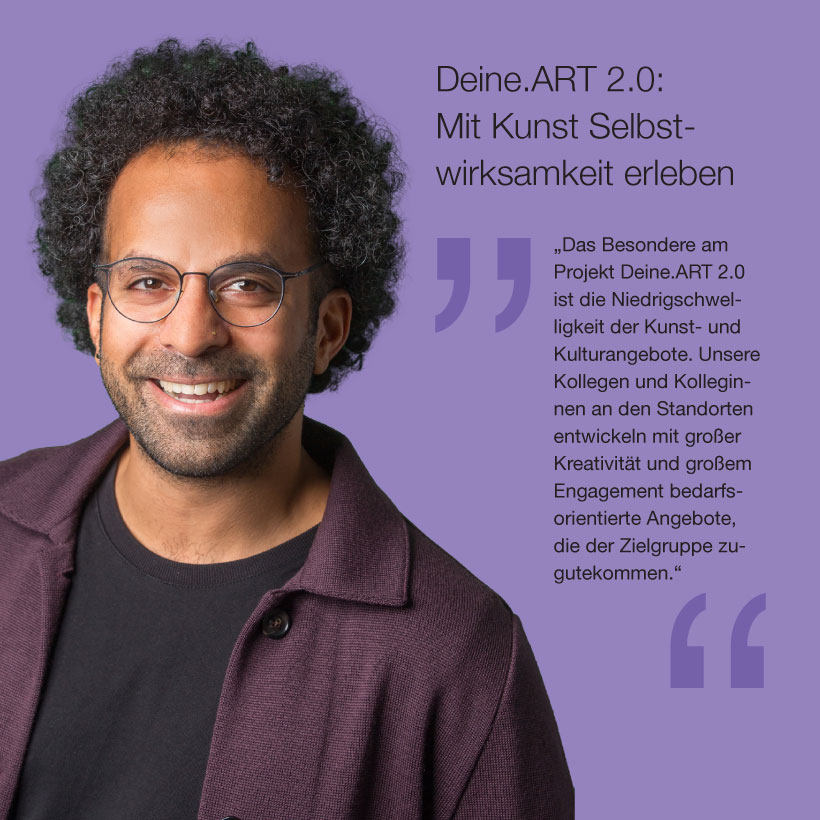Als die Pläne des Landes von den beabsichtigten Einsparungen bekannt wurden, hat es Demonstrationen mit sehr großer Beteiligung gegeben, nicht zuletzt dadurch wurde ein Teil der Kürzungen zurückgenommen. Wie lässt sich dieses große Engagement erklären?
Matthias Schmitt: Bei der Demonstration in Düsseldorf waren 24 000 Menschen angemeldet, gekommen sind über 32 000 – das macht deutlich, wie sehr das Thema die Menschen angeht, wie stark sie wahrnehmen, dass angekündigte Kürzungen auch bei ihnen vor Ort durchschlagen würden.
Dr. Frank Johannes Hensel: Die Protestbereitschaft und der hohe Grad an Mobilisierung zeigen, wie sehr dieses Thema sozial engagierte Menschen betrifft, nicht nur in eigener Sache, sondern für die Daseinsvorsorge, um die es uns geht. Mit dem landespolitischen Rückbausignal an die soziale Arbeit, das von den geplanten Kürzungen ausgeht, verlieren Mitarbeitende die Zuversicht, auf diesem Feld sicher weiterarbeiten zu können, sie verlassen das System, und am Ende bricht unsere Leistungsfähigkeit zusammen.
Was bedeuten Kürzungen in der Daseinsvorsorge für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und damit letztlich für die Demokratie?
Dr. Frank Johannes Hensel: Wenn man das Soziale schwächt, schwächt man die Gemeinschaft – und damit letztlich auch unsere Demokratie, denn das hat ja systemische Auswirkungen. Ich bin der festen Überzeugung, dass der Umgang mit Minderheiten und sozial geschwächten Gruppen entscheidend ist für den Zusammenhalt in einer Gesellschaft. Die demokratisch legitimierten Mehrheiten dürfen nicht ihre Agenda durchsetzen, ohne die Minderheiten zu schützen.
In diesem Zusammenhang möchte ich auch auf ein Missverständnis hinweisen, das in der Politik gerade wieder aufkommt: erst die Wirtschaft, dann das Soziale. Eine solche Sichtweise verkennt die Tatsache, dass eine funktionierende Daseinsvorsorge ein entscheidender Erfolgsfaktor für die Wirtschaft ist. Die Arbeitskräfte gehen bevorzugt dahin, wo es sozial, sicher und freundlich ist. Man wird keinen wirtschaftlichen Erfolg erzielen, wenn man das Soziale schleift.
Matthias Schmitt: Wir versuchen immer wieder, als Friedensstifter in die Gesellschaft hineinzuwirken, beispielsweise mit dem Theaterstück „Katze und Hund, na und? Von der Superkraft, die Frieden schafft“, das wir im Kontext der Caritas-Jahreskampagne 2024 „Frieden beginnt bei mir“ entwickelt haben und das in Kitas aufgeführt wurde. Wir sehen es mit Sorge, wenn solche Projekte weniger ermöglicht werden.
In welchem Verhältnis stehen Caritas und Freie Wohlfahrtspflege zur Politik?
Dr. Frank Johannes Hensel: Wir sind nicht das fordernde Gegenüber, sondern erachten uns als partnerschaftlich verantwortlich an der Seite der demokratischen Kräfte für das Soziale im Land. Dass wir fordernd agieren, liegt in der Natur der Nöte, um die wir uns kümmern.
Matthias Schmitt: Wir sind immer gesprächsbereit und wollen mitgestalten, aber wir haben auch das Selbstbewusstsein, dass wir eine wichtige Rolle für die Daseinsvorsorge einnehmen, die keiner Schwächung ausgesetzt sein sollte und das formulieren wir auch klar. Schwierig wird es, wenn die öffentliche Hand sich selbst voll ausstattet, also zum Beispiel bei sich Tarifsteigerungen voll refinanziert, dies aber bei den freien Trägern nicht tut. So entsteht ein Ungleichgewicht.
Ist das eine Entwicklung, die Sie beobachten?
Dr. Frank Johannes Hensel: Wir nehmen vermehrt eine Art Verstaatlichung der sozialen Daseinsvorsorge wahr, ein zunehmendes Vergessen der Subsidiarität. Der Staat fängt an, seine Dienste besser auszustatten als die der freien Träger. Das schwächt das Angebot und damit die Möglichkeiten der Wahl für die Menschen, die auf Hilfe angewiesen sind. Ich sehe dahinter keine bewusste Strategie, sondern eher einen Weg, in den man hineinstolpert. Ihn weiterzugehen, wäre unklug, denn wir als Caritas bringen ganz andere Möglichkeiten ein, mehr Ehrenamt und zusätzliche Gelder, etwa durch Stiftungen oder Spenden. Wenn man unsere Strukturen zerstört, schadet es am Ende auch den Kommunen.
Wie wichtig sind die sozialen Player für den gesellschaftlichen Zusammenhalt?
Dr. Frank Johannes Hensel: Wir sind ein Stabilitätsanker in der Gesellschaft. Wir genießen viel Vertrauen und auch Zutrauen. Uns als Caritas zu schwächen, heißt, die Gesellschaft selbst zu schwächen. Wir sind die verlässlichen Kräfte da draußen, wir lieben und leben Minderheitenschutz und sind Garanten einer demokratischen, offenen, freundlichen Gesellschaft.
Wie kann die Caritas ihre Position in unruhigen Zeiten verbessern?
Dr. Frank Johannes Hensel: Wir sind ein starker Arm der Kirche von hoher persönlicher und gesellschaftlicher Relevanz. Wir werden nicht die Ersten sein, die wegbrechen, aber wir vertragen und verdienen keine Destabilisierung.
Matthias Schmitt: Das haben wir durch verschiedene Krisen hindurch bewiesen. Wir stehen noch stabil in der sozialen Landschaft und punkten insofern durch unsere Solidität und Verlässlichkeit.
Sehen Sie Möglichkeiten, mit geplanten und noch kommenden Kürzungen kreativ umzugehen? Wie muss sich die Caritas in der Zukunft wandeln?
Dr. Frank Johannes Hensel: Wenn wir die beiden großen Herausforderungen nehmen, die finanziellen Mittel und die Menschen, mit denen wir arbeiten, dann müssen wir es in der Caritas-Familie schaffen, über Dekanats- und Bistumsgrenzen hinweg verbundener zusammenzuarbeiten, Expertise zu bündeln und sie überregional zur Verfügung zu stellen.
Matthias Schmitt: Mit Blick auf den DiCV sind der Stiftungsbereich und das Fundraising ein wichtiges Standbein für die Zukunft. Dadurch wird sehr viel ermöglicht von Menschen, die das Glück haben, dass sich in ihrem Leben Vermögen angesammelt hat, und die das auch gerne gut eingesetzt wissen möchten. So kann staatliche Förderung zwar nicht ersetzt werden, aber es ist eine wichtige zusätzliche finanzielle Stütze. Wir sind in dem Bereich sehr professionell aufgestellt und wollen das weiter gut entwickeln.
Was kommt in der Zukunft auf die Caritas und ihre Mitarbeitenden zu?
Dr. Frank Johannes Hensel: Uns wird es weiter brauchen, und wir müssen dafür sorgen, dass wir mit genug Kräften an den Themen bleiben können. Große Chancen sehe ich auch in einer neuen Kommunikationskultur mithilfe von digitalen Techniken. Das stärkt unsere Arbeit und Erreichbarkeit. Außerdem wird die Künstliche Intelligenz insofern ein Thema, als wir unsere Kräfte noch stärker für die Betreuung der Klientinnen und Klienten zur Verfügung stellen können. Den Menschen zu ihrem Recht zu verhelfen, ist ein enormer Verwaltungsaufwand, und da hoffen wir, durch moderne Technik entlastet zu werden.
Matthias Schmitt: Das sind unterstützende, flankierende Maßnahmen, die teilweise schon ganz konkret in der Entwicklung sind und die dann Beratung von der reinen Faktenwiedergabe befreien und Kapazitäten für anderes freisetzen können. Ein Beispiel ist die Website www.das-steht-dir-zu.de, auf der sich Menschen über mögliche Ansprüche auf staatliche Leistungen informieren können. Da wird dieser Ansatz bereits umgesetzt, und das werden wir zukunftsgerichtet weiterentwickeln.
Der Titel der Caritas-Jahreskampagne 2025 lautet: „Da kann ja jeder kommen. Caritas öffnet Türen“. Wie ist die Kampagne zu verstehen?
Matthias Schmitt: Wir wollen gern Türen aufstellen und damit zeigen, wie wir Türen öffnen – tagtäglich, in all unseren Diensten, für alle Menschen, die suchen und in Nöten sind. Da stehen die Türen immer offen, deswegen ist es gut, das noch einmal in den Blick zu rücken.
Dr. Frank Johannes Hensel: Der Vorsatz „Da kann ja jeder kommen“ ist ganz bewusst so gewählt, dass man kurz stutzt. Gemeint ist, dass wir uns an den Nöten der Menschen orientieren und nicht an Merkmalen wie Alter, Geschlecht, Kultur oder Religion. Wir sehen und beachten die Würde aller, dafür stehen unsere Türen offen.
Das Gespräch führte Barbara Allebrodt.